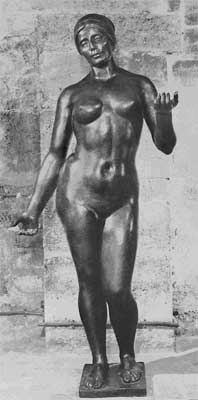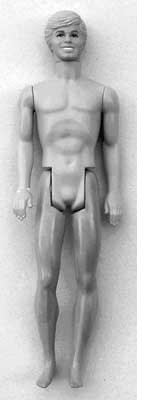Bei der einleitenden Betrachtung
zweier Abbildungen (Maillols „Sommer“ von 1910 und Rodins „Victor
Hugo“ von 1897) werden einzelne Aspekte der Bildbetrachtung geübt.
So lernen die Schüler z. B. auf Haltung und Proportionen
als Ausdruck von Individualisierung oder Idealisierung der
Skulpturen zu achten.
Mit dem Sommer bearbeitet Maillol eine
allegorische Figur und folgt damit einer bildhauerischen Tradition, die
es bis in die Gegenwart hinein der Öffentlichkeit erleichtert, nackte
Frauen- oder auch Männergestalten im städtischen Raum zu
ertragen. Anders verhält es sich, wenn etwa eine unbekleidete Figur
eine identifizierbare Person oder gar eine bekannte Gestalt aus Politik
oder Zeitgeschichte darstellen würde. Dann ist in der Regel Aufregung
und Skandal gegeben. Dieses Problem kommt nicht erst durch den seit der
Mitte des 19. Jh bestimmenden Wandel zum Realismus auf. Schon der klassizistische
Bildhauer Canova fertigte ein Standbild von Napoleon, das den französischenFeldherrn
und Kaiser nackt zeigte.
Victor Hugo (1802-85) ist wohl der bedeutendste
Schriftsteller der französischen Romantik . Romane: 'Notre-Dame de
Paris' lieferte die Vorlage für den Film 'Der Glöckner von Notre-Dame',
'Les Misérables', ein historisierender Kriminalroman.
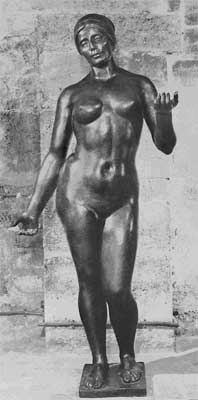
|
Was lässt sich über Geschlecht
und Alter sagen?
Kann aus Körperbau und Haltung auf
einen Typ geschlossen werden?
Gibt es:
Auffälligkeiten in der Proportionierung
der Körper?
Besonderheiten der Haltung?
Lässt sich die Gestik,
Mimik
lesen als nach innen gerichtete Empfindung, oder
als nach aussen adressierte Mitteilung?
Sind die Figuren a) als Individuen,
Personen zu benennen (Versuch einer Namensgebung)
oder wirken sie b) als Allegorien
stilisiert (Versuch einer Deutung)
Aufklärung über die Titel
Wie könnte man sich die Allegorie
des Sommers durch Attribute verdeutlicht vorstellen?
Wer war Victor Hugo und wie könnte
man sich die Person verdeutlicht vorstellen?
Empfindet man die Nacktheit als
angemessen für eine Allegorie?
für einen Schriftsteller? |

|
Fazit: Es fällt nicht leicht, die idealisierte
Figur als Allegorie zu erkennen, wie es anderersteits ebenso schwer
fällt in einem nackten alten Mann die Persönlichkeit des
Schriftstellers Victor Hugo zu vermuten.
Maillol, Aristide
(1861-1944) gilt nach Rodin als bedeutendster Anreger für die Plastik
in der ersten Hälfte des 20. Jh. Sein bekanntestes Werk dürfte
die 'La Méditerranée' (1902-05) sein, auch eine allegorische
Figur. Im Gegensatz zu Rodins Expressivität und einer impressionistisch
anmutenden Oberflächengestaltung geht es ihm eher um eine Erneuerung
klassizistischer Ideale. Damit wirken seine Aktdarstellungen auch noch
auf Künstler des 3.Reichs für vorbildlich.
Rodin, Auguste (1840-1917)
entwickelt seit 1877 einen plastischen Stil, der im Zusammenhang mit dem
zeitgleichen Impressionismus gesehen wird. Im letzten Jahrzehnt des 19.
Jh arbeitet er an einem Denkmalauftrag für den Dichter Balzac, von
dem es eine nackte und eine bekleidete (im Schlafrock) Version gibt, die
für die Franzosen erst 1939 akzeptabel war und in Bronze gegossen
wurde. |

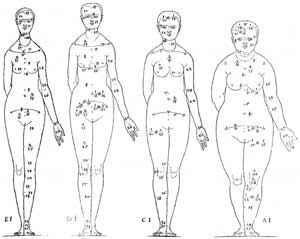 Auf
der Suche nach der "Schönheit" hat Dürer in seiner Proportionslehre
weibliche und männliche Körper mit unterschiedlichsten Proportionierungen
vermessen und konstruiert, hat Zahlenreihen aufgestellt, geometrische Streckungs-
und Stauchungsverfahren erprobt. Am Ende hat er sich doch meist der "Regel"
des Vitruv unterworfen, die auch von Leonardo da Vinci in seiner
berühmten Illustration verewigt wurde. Dürer hat am Ende seiner
umfangreichen Suche nach der Schönheit bekannt, dass es ihm nicht
vergönnt war eine endgültige Lösung zu finden. Man kann
aber davon ausgehen, dass er in seinem Meisterstich "Adam und Eva" seine
Vorstellung idealer menschlicher Körper ins Bild gesetzt hat.
Auf
der Suche nach der "Schönheit" hat Dürer in seiner Proportionslehre
weibliche und männliche Körper mit unterschiedlichsten Proportionierungen
vermessen und konstruiert, hat Zahlenreihen aufgestellt, geometrische Streckungs-
und Stauchungsverfahren erprobt. Am Ende hat er sich doch meist der "Regel"
des Vitruv unterworfen, die auch von Leonardo da Vinci in seiner
berühmten Illustration verewigt wurde. Dürer hat am Ende seiner
umfangreichen Suche nach der Schönheit bekannt, dass es ihm nicht
vergönnt war eine endgültige Lösung zu finden. Man kann
aber davon ausgehen, dass er in seinem Meisterstich "Adam und Eva" seine
Vorstellung idealer menschlicher Körper ins Bild gesetzt hat.