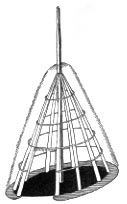 Das
vielleicht grundlegendste Bauelement sind Stützen. Wenn wir an eine
elementare Behausung wie das Zelt denken, dann wird es im Ursprung
wohl bei Indianern oder anderen Nomaden aus hölzernen Stangen und
Tierhäuten (oder Gras, Moos) gebaut und erfüllt in der Hauptsache
die Funktion eines mobilen 'Dachs über dem Kopf'. Tatsächlich
sind in den Formen der Zelte schon die grundlegenden Probleme des Bauens
enthalten. So lassen sich die Zeltstangen zu einem stabilen Gestell hauptsächlich
auf zwei Weisen zusammenstellen:
Das
vielleicht grundlegendste Bauelement sind Stützen. Wenn wir an eine
elementare Behausung wie das Zelt denken, dann wird es im Ursprung
wohl bei Indianern oder anderen Nomaden aus hölzernen Stangen und
Tierhäuten (oder Gras, Moos) gebaut und erfüllt in der Hauptsache
die Funktion eines mobilen 'Dachs über dem Kopf'. Tatsächlich
sind in den Formen der Zelte schon die grundlegenden Probleme des Bauens
enthalten. So lassen sich die Zeltstangen zu einem stabilen Gestell hauptsächlich
auf zwei Weisen zusammenstellen:
a) Als Dreibock zu einem runden und spitzen Kegel, bei dem die Sparren an ihrem Fuß eingegraben und an den sich gegeneinander neigenden Spitzen verbunden werden. So ein Gestell ist auch ohne Mittelpfosten stabil und es gewinnt durch zusätzliche Sparren an Weite. Der runde Hüttenboden kann nestartig vertieft werden.

b) Eine prismatische Form entsteht, wenn zuerst ein Pfostengestell oder Joch in der Form eines Tors, also aus zwei senkrechten Ständern und einem horizontalen Firstbalken errichtet wird. An den Firstbalken werden dann die Sparren angelehnt, die an ihrem Fuß zur Stabilisierung auch eingegraben werden.

Fragen:
- Welche Form ist stabiler?
- Wie stabilisiert man ein Tor?
- Wie schafft man ein Auflager für den Firstbalken?
- Worin bestehen die Nachteile dieser einfachen Zeltformen?
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Rekonstruktion eines Pfahlbaus vom Ledrer See in Oberitalien. Der Bau besitzt noch keine Wände. Er ist wie ein Zelt auf einer Plattform errichtet und mit Stroh eingedeckt.
 Der
Begriff Wand kommt von winden und geht zurück auf eine Tradition,
die man heute noch im Bauernhofmuseum findet, oder wenn alte Fachwerkhäuser
restauriert werden. Beim Fachwerksbau bestand die Wand aus einem Rahmen
von vertikalen Ständern und horizontalen Balken. Die Zwischenräume
wurden mit einem Geflecht aus Astwerk (vorzugsweise Weide) versehen und
mit Lehm verputzt. Fachwerk bedeutet ursprünglich Flechtwerk.
Der
Begriff Wand kommt von winden und geht zurück auf eine Tradition,
die man heute noch im Bauernhofmuseum findet, oder wenn alte Fachwerkhäuser
restauriert werden. Beim Fachwerksbau bestand die Wand aus einem Rahmen
von vertikalen Ständern und horizontalen Balken. Die Zwischenräume
wurden mit einem Geflecht aus Astwerk (vorzugsweise Weide) versehen und
mit Lehm verputzt. Fachwerk bedeutet ursprünglich Flechtwerk.  In
Regionen, wo es an Holz mangelt, werden Wände als Mauer ausgebildet.
Die dazu notwendigen Steine fallen beim Bestellen des Ackers an. Die Bauern
räumen die beim Pflügen gelockerten Steine an den Feldrand, wo
die so gebildeten Mauern verhindern, daß der fruchtbare Ackerboden
vom Regen weggeschwemmt oder vom Wind weggeweht wird. Zum Stabilisieren,
binden solcher Mauern aus Feldsteinen, nimmt man Lehm oder Kalk.
Bei Hauswänden verhindert solches Verputzen auch, daß
sich in den Ritzen Ungeziefer halten und vermehren kann. In Landschaften
mit einem natürlichen Vorkommen von Lehm ist dieser seit alters her
ein geschätztes Baumaterial für Mauern. Entweder formt man daraus
Ziegel,
die man in der Sonne trocknet oder im Feuer brennt und dann zu einem Mauerverband
aufschichtet, oder man stampft den Lehm in einer Schalung zusammen mit
Stroh und Steinen zu einer verdichteten Masse, die beim Trocknen eine stabile
Mauer bildet. Die aufwändigste Form der Mauer ist die aus Hausteinen
gebildete. Die Blöcke werden im Steinbruch gebrochen, auf Größe
gesägt und individuell auf Form behauen. Je nach der Härte des
Materials erfordert dies bereits einen erheblichen Einsatz von Arbeitskräften,
Werkzeugen und Transporttechnik.
In
Regionen, wo es an Holz mangelt, werden Wände als Mauer ausgebildet.
Die dazu notwendigen Steine fallen beim Bestellen des Ackers an. Die Bauern
räumen die beim Pflügen gelockerten Steine an den Feldrand, wo
die so gebildeten Mauern verhindern, daß der fruchtbare Ackerboden
vom Regen weggeschwemmt oder vom Wind weggeweht wird. Zum Stabilisieren,
binden solcher Mauern aus Feldsteinen, nimmt man Lehm oder Kalk.
Bei Hauswänden verhindert solches Verputzen auch, daß
sich in den Ritzen Ungeziefer halten und vermehren kann. In Landschaften
mit einem natürlichen Vorkommen von Lehm ist dieser seit alters her
ein geschätztes Baumaterial für Mauern. Entweder formt man daraus
Ziegel,
die man in der Sonne trocknet oder im Feuer brennt und dann zu einem Mauerverband
aufschichtet, oder man stampft den Lehm in einer Schalung zusammen mit
Stroh und Steinen zu einer verdichteten Masse, die beim Trocknen eine stabile
Mauer bildet. Die aufwändigste Form der Mauer ist die aus Hausteinen
gebildete. Die Blöcke werden im Steinbruch gebrochen, auf Größe
gesägt und individuell auf Form behauen. Je nach der Härte des
Materials erfordert dies bereits einen erheblichen Einsatz von Arbeitskräften,
Werkzeugen und Transporttechnik.


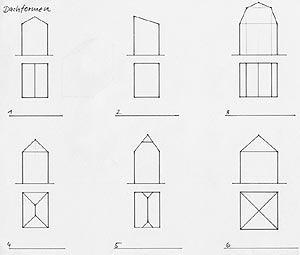 In
der Architektur funktioniert die Verständigung zwischen Architekt,
Bauherr und Bauarbeiter über gezeichnete Pläne. Grundriß
und Aufriß haben sich dabei sehr früh als die häufigsten
Formen herausgebildet.
In
der Architektur funktioniert die Verständigung zwischen Architekt,
Bauherr und Bauarbeiter über gezeichnete Pläne. Grundriß
und Aufriß haben sich dabei sehr früh als die häufigsten
Formen herausgebildet.
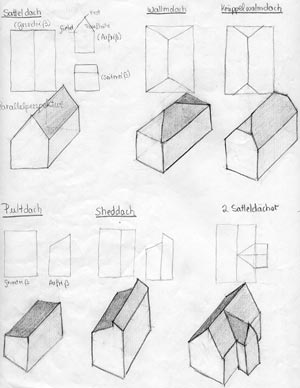 Für
das Schrägbild existieren in der technischen Zeichnung zwei genormte
(DIN 5) parallelperspektivische Verfahren, die Isometrie, dier mit einem
Maßstaß 1:1 arbeitet, und das Objekt unter einem Winkel von
300 darstellt, und die Dimetrie, die mit zwei Maßen 1:1:1/2 arbeitet
und ihr Objekt unter einem Winkel von 450
(Kavaliersperspektive) zwei Winkeln von 70
und 420 oder zwei Winkeln von je 450
(Militärperspektive) arbeitet. Da wir keine technischen Zeichner ausbilden,
ziehen wir hier das Freihandzeichnen der Konstruktion mit dem Lineal vor.
Die Schüler sollen durch solche einfacheren Übungen eine gewisse
Sicherheit im Zeichnen von Parallelen, gleichen Winkeln, geraden Linien
und in der Aufteilung eines Zeichenblatts erlangen. Im gegebenen Fall waren
an der Tafel jeweils Grund- und Aufriß dargestellt, während
das Schrägbild jeder selbst zeichnen sollte.
Für
das Schrägbild existieren in der technischen Zeichnung zwei genormte
(DIN 5) parallelperspektivische Verfahren, die Isometrie, dier mit einem
Maßstaß 1:1 arbeitet, und das Objekt unter einem Winkel von
300 darstellt, und die Dimetrie, die mit zwei Maßen 1:1:1/2 arbeitet
und ihr Objekt unter einem Winkel von 450
(Kavaliersperspektive) zwei Winkeln von 70
und 420 oder zwei Winkeln von je 450
(Militärperspektive) arbeitet. Da wir keine technischen Zeichner ausbilden,
ziehen wir hier das Freihandzeichnen der Konstruktion mit dem Lineal vor.
Die Schüler sollen durch solche einfacheren Übungen eine gewisse
Sicherheit im Zeichnen von Parallelen, gleichen Winkeln, geraden Linien
und in der Aufteilung eines Zeichenblatts erlangen. Im gegebenen Fall waren
an der Tafel jeweils Grund- und Aufriß dargestellt, während
das Schrägbild jeder selbst zeichnen sollte.
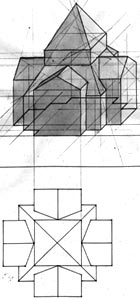
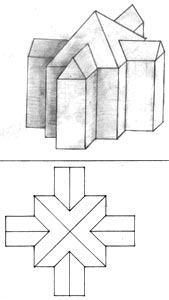 Komplexere
Dachformen lassen sich nicht mehr so einfach freihand darstellen. Da der
methodische Weg sich kaum ändert und überschaubare Regeln gelten,
sind solche Übungen den Schülern relativ gut zu vermitteln. Solche
Zeichnungen sind auch im konstruktiven Bereich klar zu beurteilen, weil
der gedankliche Weg oder die Einhaltung der Regeln zu richtigen oder falschen
Lösungen führen oder auch einzelne Fehler klar angegeben werden
können. Zur Klärung der plastischen Verhältnisse kann man
die lineare Zeichnung mit Schraffuren oder durch Lavierung mit Beize oder
verdünnter Tusche als Körper verdeutlichen lassen.
Komplexere
Dachformen lassen sich nicht mehr so einfach freihand darstellen. Da der
methodische Weg sich kaum ändert und überschaubare Regeln gelten,
sind solche Übungen den Schülern relativ gut zu vermitteln. Solche
Zeichnungen sind auch im konstruktiven Bereich klar zu beurteilen, weil
der gedankliche Weg oder die Einhaltung der Regeln zu richtigen oder falschen
Lösungen führen oder auch einzelne Fehler klar angegeben werden
können. Zur Klärung der plastischen Verhältnisse kann man
die lineare Zeichnung mit Schraffuren oder durch Lavierung mit Beize oder
verdünnter Tusche als Körper verdeutlichen lassen.

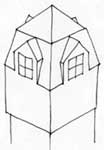








 Im
süddeutschen Raum findet man nahezu in jedem Dorf hinreichendes Anschauungsmaterial
um Turmdächer von Kirchen, Stadttoren oder Wassertürmen
auch direkt nach der Anschauung zeichnen zu lassen. Ein Spaziergang rund
um unsere Schule in einer Doppelstunde liefert ein gut bestücktes
Sortiment. Die Schüler bewaffnen sich mit einem Skizzenblock und liefern
am Ende der Doppelstunde mindestens drei Zeichnungen ab, die in einer Folgestunde
nach Fotos, die der Lehrer gemacht hat, in Grund- und Aufriß analysiert
werden. Aus diesen Anregungen erwachsen dann eigene Entwürfe. Ganz
ehrgeizige verputzen die Wandflächen mit Moltofill, oder decken das
Dach mit Kupferfolie ein.
Im
süddeutschen Raum findet man nahezu in jedem Dorf hinreichendes Anschauungsmaterial
um Turmdächer von Kirchen, Stadttoren oder Wassertürmen
auch direkt nach der Anschauung zeichnen zu lassen. Ein Spaziergang rund
um unsere Schule in einer Doppelstunde liefert ein gut bestücktes
Sortiment. Die Schüler bewaffnen sich mit einem Skizzenblock und liefern
am Ende der Doppelstunde mindestens drei Zeichnungen ab, die in einer Folgestunde
nach Fotos, die der Lehrer gemacht hat, in Grund- und Aufriß analysiert
werden. Aus diesen Anregungen erwachsen dann eigene Entwürfe. Ganz
ehrgeizige verputzen die Wandflächen mit Moltofill, oder decken das
Dach mit Kupferfolie ein. Die
Säule ist ihrer Idee nach ein in Stein idealisiert nachgebildeter
Baumstamm. Das ist insbesondere an den ägyptischen und griechischen
Säulen auch noch deutlich ablesbar. Zur Symbolik des Baumstamms kommt
bei den Griechen eine antropomorphe, der menschlichen Gestalt nachgebildete
Symbolisierung hinzu.
Die
Säule ist ihrer Idee nach ein in Stein idealisiert nachgebildeter
Baumstamm. Das ist insbesondere an den ägyptischen und griechischen
Säulen auch noch deutlich ablesbar. Zur Symbolik des Baumstamms kommt
bei den Griechen eine antropomorphe, der menschlichen Gestalt nachgebildete
Symbolisierung hinzu.
 Aus
diesen beiden Gründen entsteht die Idee, Pfosten am Fußende
mit einem Pfahlschuh zu versehen, sie auf eine hölzerne oder
steinerne Platte zu stellen. An ihrem Kopfende tragen sie häufig eine
erhebliche Last, ein Gebälk, ein Dach, einen Speicher. An solchen
Stellen ist es günstig, wenn die Auflagefläche des Pfostens möglichst
groß ist. Ein Sattelholz oder eine ins Balkeneck eingespreizte
Knagge
schaffen hier Abhilfe. Für den Fall, daß ein Speicher
von einem Pfostengestell
Aus
diesen beiden Gründen entsteht die Idee, Pfosten am Fußende
mit einem Pfahlschuh zu versehen, sie auf eine hölzerne oder
steinerne Platte zu stellen. An ihrem Kopfende tragen sie häufig eine
erhebliche Last, ein Gebälk, ein Dach, einen Speicher. An solchen
Stellen ist es günstig, wenn die Auflagefläche des Pfostens möglichst
groß ist. Ein Sattelholz oder eine ins Balkeneck eingespreizte
Knagge
schaffen hier Abhilfe. Für den Fall, daß ein Speicher
von einem Pfostengestell  getragen
wird, müssen die in ihm gespeicherten Vorräte nicht nur gegen
Regen von oben, sondern auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten
geschützt werden. Zudem benützt eine ganze Reihe von Schädlingen
und Räubern Stämme und Pfosten als Leitern, um an Früchte
oder hoch lagernde Vorräte zu kommen.
getragen
wird, müssen die in ihm gespeicherten Vorräte nicht nur gegen
Regen von oben, sondern auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten
geschützt werden. Zudem benützt eine ganze Reihe von Schädlingen
und Räubern Stämme und Pfosten als Leitern, um an Früchte
oder hoch lagernde Vorräte zu kommen.  Es
gibt also eine ganze Reihe von Gründen, um Pfosten auch an ihrem Kopfende
mit einem 'Kragen' oder 'Sattel' zu versehen. So ist im ganzen Mittelmeerraum
eine Art von Getreidespeicher heute noch zu finden, der auf vier
hölzernen Pfosten oder steinernen Säulen steht, die an ihrem
Kopfende eine weit überkragende eckige oder runde Steinplatte
(Mausplatte) tragen, die dem darüber liegenden Speicherbau als Auflager
dienen. Das hier abgebildete Beispiel stammt aus dem nördlichen Spanien
(Asturien).
Es
gibt also eine ganze Reihe von Gründen, um Pfosten auch an ihrem Kopfende
mit einem 'Kragen' oder 'Sattel' zu versehen. So ist im ganzen Mittelmeerraum
eine Art von Getreidespeicher heute noch zu finden, der auf vier
hölzernen Pfosten oder steinernen Säulen steht, die an ihrem
Kopfende eine weit überkragende eckige oder runde Steinplatte
(Mausplatte) tragen, die dem darüber liegenden Speicherbau als Auflager
dienen. Das hier abgebildete Beispiel stammt aus dem nördlichen Spanien
(Asturien).
