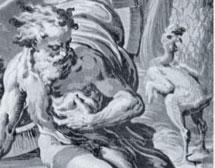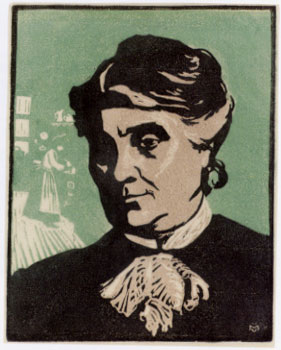 Der
Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele
Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen
1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die
sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt
uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen
Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann. Der
Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele
Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen
1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die
sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt
uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen
Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.
In der Tat ähnelt die Tontrennung
in ihrer Wirkung einem malerischen Prinzip, das bereits im 17. Jh. im Fresko
und in der Pinselzeichnung verbreitet war, einer Malerei mit drei Tönen,
die nicht der plastischen Form der Objekte modellierend nachspürt,
sondern Lichter, Schatten- bzw Dunkelflächen und Mitteltöne erfasst. |
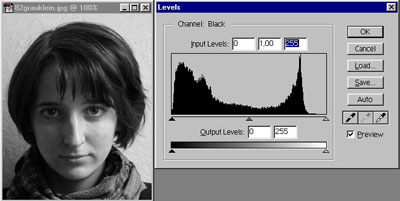 Für
die Verteilung der Helligkeitswerte auf die Anzahl der Pixel im Bild stellt
Photoshop ein Histogramm zur Verfügung. Das Diagramm erklärt
sich weitgehend selbst: Im unteren Balken zeigt ein Graukeil den Tonumfang
von 256 Tönen an, der sich durch Verschieben der Marken auch einengen
lässt. Das obere Fenster zeigt die Helligkeitsverteilung mit deutlichen
Spitzenwerten im dunklen wie im hellen Bereich. Ganz rechts ein bildunwirksamer
Bereich, für den keine Pixel gezählt werden, und den wir als
erstes wegschneiden, - rechten Regler wenig nach links verschieben.
Für
die Verteilung der Helligkeitswerte auf die Anzahl der Pixel im Bild stellt
Photoshop ein Histogramm zur Verfügung. Das Diagramm erklärt
sich weitgehend selbst: Im unteren Balken zeigt ein Graukeil den Tonumfang
von 256 Tönen an, der sich durch Verschieben der Marken auch einengen
lässt. Das obere Fenster zeigt die Helligkeitsverteilung mit deutlichen
Spitzenwerten im dunklen wie im hellen Bereich. Ganz rechts ein bildunwirksamer
Bereich, für den keine Pixel gezählt werden, und den wir als
erstes wegschneiden, - rechten Regler wenig nach links verschieben. 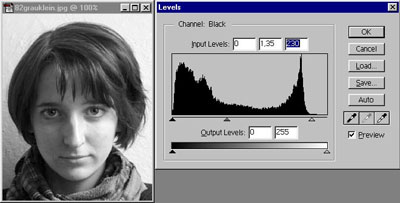 Mit
dem mittleren der drei Regler heben wir sodann die Helligkeit und den Kontrast
in den dunklen Partien leicht an, um hier noch ein Minimum an Zeichnung
(Auge und Wange) zu erhalten. Ein Verschieben des Mitteltonbereichs nach
rechts würde den dunklen Bereich noch weiter in die hellen Töne
hinein verlagern und die Differenzierung innerhalb der dunklen Gesichtshälfte
noch stärker reduzieren.
Mit
dem mittleren der drei Regler heben wir sodann die Helligkeit und den Kontrast
in den dunklen Partien leicht an, um hier noch ein Minimum an Zeichnung
(Auge und Wange) zu erhalten. Ein Verschieben des Mitteltonbereichs nach
rechts würde den dunklen Bereich noch weiter in die hellen Töne
hinein verlagern und die Differenzierung innerhalb der dunklen Gesichtshälfte
noch stärker reduzieren.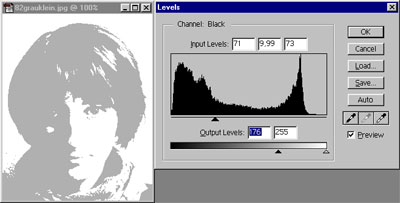 Für
den Druck in zwei Farben suchen wir nun einen mittleren Ton. Dazu legen
wir die Regler für die Tonwertspreizung, die hellen und die dunklen
Töne, auf die Position des mittleren Tonwertreglers. Es sind einige
Versuche notwendig, um herauszufinden, in welcher Position sich eine günstige
Form der Tonflächen ergibt, das Gesicht seine Charakteristik behält,
die Formen von Augen, Nase und Mund hinreichend klar gezeichnet erscheinen.
Wenn wir diese Position gefunden haben, reduzieren wir mit dem unteren
Regler noch den Tonumfang der Grauskala. Ein starker Schwarzweißkontrast
würde dem jugendlichen weiblichen Gesicht eine unnötige Härte
geben. Wir speichern dieses Bild ab als "Grauton".
Für
den Druck in zwei Farben suchen wir nun einen mittleren Ton. Dazu legen
wir die Regler für die Tonwertspreizung, die hellen und die dunklen
Töne, auf die Position des mittleren Tonwertreglers. Es sind einige
Versuche notwendig, um herauszufinden, in welcher Position sich eine günstige
Form der Tonflächen ergibt, das Gesicht seine Charakteristik behält,
die Formen von Augen, Nase und Mund hinreichend klar gezeichnet erscheinen.
Wenn wir diese Position gefunden haben, reduzieren wir mit dem unteren
Regler noch den Tonumfang der Grauskala. Ein starker Schwarzweißkontrast
würde dem jugendlichen weiblichen Gesicht eine unnötige Härte
geben. Wir speichern dieses Bild ab als "Grauton".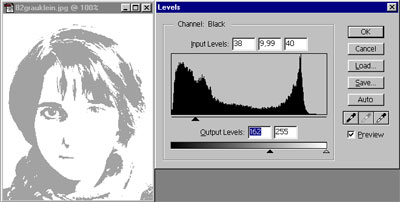 Die
oben gefundene mittlere Tonfläche enthält in ihren Grenzen alle
denkbaren Tonflächen eines tieferen Tons. Anders gesagt: Ein dunklerer
Ton kann sich nicht außerhalb dieser Flächen befinden. Für
eine höhere Differenzierung der Gesichtsform sind einer oder zwei
weitere dunklere Töne hilfreich. Wir suchen wieder eine Position für
den Mitteltonregler ohne Tonwertspreizung (alle drei Regler übereinander),
in der die Zeichnung der Gesichtsteile klare Formen ergibt. Wenn wir eine
solche Position ermittelt haben, was wiederum einige Versuche voraussetzt,
reduzieren wir mit dem unteren Regler den Tonwertumfang der Grauskala,
diesmal allerdings so, dass die dunkle Fläche auch einen tieferen
Ton besitzt als beim ersten Mal. Wir speichern dieses Bild ab als "Schwarzton".
Die
oben gefundene mittlere Tonfläche enthält in ihren Grenzen alle
denkbaren Tonflächen eines tieferen Tons. Anders gesagt: Ein dunklerer
Ton kann sich nicht außerhalb dieser Flächen befinden. Für
eine höhere Differenzierung der Gesichtsform sind einer oder zwei
weitere dunklere Töne hilfreich. Wir suchen wieder eine Position für
den Mitteltonregler ohne Tonwertspreizung (alle drei Regler übereinander),
in der die Zeichnung der Gesichtsteile klare Formen ergibt. Wenn wir eine
solche Position ermittelt haben, was wiederum einige Versuche voraussetzt,
reduzieren wir mit dem unteren Regler den Tonwertumfang der Grauskala,
diesmal allerdings so, dass die dunkle Fläche auch einen tieferen
Ton besitzt als beim ersten Mal. Wir speichern dieses Bild ab als "Schwarzton".







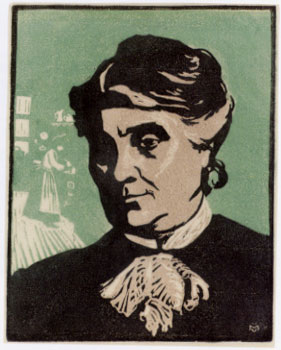 Der
Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele
Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen
1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die
sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt
uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen
Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.
Der
Hochdruck um 1900 zeigt sich stark beeiflusst von der Fotografie. Gabriele
Münter, Lebensabschnittsgefährtin von Kandinsky, hat zwischen
1902 und 1907 eine Reihe von Portraits in Holz und Linol geschnitten, die
sehr stark die Sprache der fotografischen Tontrennung sprechen. Das zeigt
uns, dass man auch ohne Photoshop oder andere andere Prozesse der technischen
Bildwandlung zu solchen Ergebnissen kommen kann.
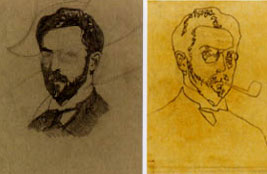 Die
nebenstehenden Zeichnungen von Gabriele Münter sind Vorarbeiten zu
einem Linolschnitt. Das Portrait links zeigt den Maler Kandinsky in einer
Bleistiftzeichnung, bei der sie einen großen Teil der schwarzen Flächen
mit dem Bleistift ausschraffiert hat. Rechts eine seitenverkehrte Pause
zur Übertragung der Vorlage auf den Druckstock. Hier hat Münter
nur noch die Umrisse der zu schneidenden Flächen mit kräftigem
Strich durchgepaust. Diese Pause ließ sich leicht auf die Linolplatte
umdrucken.
Die Arbeiten von Münter sind dem Katalog der Ausstellung >Gabriele
Münter - Das druckgrafische Werk< (Lehnbachhaus München) entnommen.
Diesem Vorgang entnehmen wir den Hinweis, dass wir unsere mit Photoshop
erstellten Entwürde für die beiden Druckfarben noch horizontal
spiegeln müssen, bevor wir sie ausdrucken.
Die
nebenstehenden Zeichnungen von Gabriele Münter sind Vorarbeiten zu
einem Linolschnitt. Das Portrait links zeigt den Maler Kandinsky in einer
Bleistiftzeichnung, bei der sie einen großen Teil der schwarzen Flächen
mit dem Bleistift ausschraffiert hat. Rechts eine seitenverkehrte Pause
zur Übertragung der Vorlage auf den Druckstock. Hier hat Münter
nur noch die Umrisse der zu schneidenden Flächen mit kräftigem
Strich durchgepaust. Diese Pause ließ sich leicht auf die Linolplatte
umdrucken.
Die Arbeiten von Münter sind dem Katalog der Ausstellung >Gabriele
Münter - Das druckgrafische Werk< (Lehnbachhaus München) entnommen.
Diesem Vorgang entnehmen wir den Hinweis, dass wir unsere mit Photoshop
erstellten Entwürde für die beiden Druckfarben noch horizontal
spiegeln müssen, bevor wir sie ausdrucken.