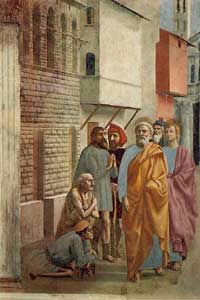 Reproduktion
von Texten, Bildern oder dreidimensionalen Objekten bedeutet in der Regel
Übertragung von Information von einer Darstellungsform in eine andere,
von einem Medium in ein anderes. Sofern bei der Reproduktion nicht ein
Klonen = identisches Nachbilden angestrebt wird, stellt sich die Frage,
welche Objekt-, Bild-, Texteigenschaften reproduziert werden sollen. Ein
Fresko aus der Renaissance, befindlich in der Kirche S.Maria del Carmine
in Florenz beispielsweise, soll in seinem bildhaften Eindruck transportabel
gemacht werden für einen Kunsterzieher, der es in Pfarrkirchen seinen
Schülern zeigen will. Es soll beispielsweise auf fotografischem Film
abgelichtet werden. Dabei entsteht nicht annähernd eine identische
Nachbildung des Freskos, sondern eine analoge Kopie, eine fotografische
Reproduktion auf Film oder Fotopapier, vielleicht nur in schwarz/weiß
und in der Größe und Auflösung, die das verwendete
Filmmaterial hergibt: auf 35 mm Filmbreite (Kleinbild) bei einer Filmempfindlichkeit
(Auflösungsvermögen) von 400 ASA wegen der schlechten Beleuchtungsbedingungen
in der Kapelle. Die Analogie von Vorbild und Nachbild beschränkt sich
also auf proportionale Ähnlichkeit der Formen und Ähnlichkeit
in der Helligkeitsverteilung.
Reproduktion
von Texten, Bildern oder dreidimensionalen Objekten bedeutet in der Regel
Übertragung von Information von einer Darstellungsform in eine andere,
von einem Medium in ein anderes. Sofern bei der Reproduktion nicht ein
Klonen = identisches Nachbilden angestrebt wird, stellt sich die Frage,
welche Objekt-, Bild-, Texteigenschaften reproduziert werden sollen. Ein
Fresko aus der Renaissance, befindlich in der Kirche S.Maria del Carmine
in Florenz beispielsweise, soll in seinem bildhaften Eindruck transportabel
gemacht werden für einen Kunsterzieher, der es in Pfarrkirchen seinen
Schülern zeigen will. Es soll beispielsweise auf fotografischem Film
abgelichtet werden. Dabei entsteht nicht annähernd eine identische
Nachbildung des Freskos, sondern eine analoge Kopie, eine fotografische
Reproduktion auf Film oder Fotopapier, vielleicht nur in schwarz/weiß
und in der Größe und Auflösung, die das verwendete
Filmmaterial hergibt: auf 35 mm Filmbreite (Kleinbild) bei einer Filmempfindlichkeit
(Auflösungsvermögen) von 400 ASA wegen der schlechten Beleuchtungsbedingungen
in der Kapelle. Die Analogie von Vorbild und Nachbild beschränkt sich
also auf proportionale Ähnlichkeit der Formen und Ähnlichkeit
in der Helligkeitsverteilung.
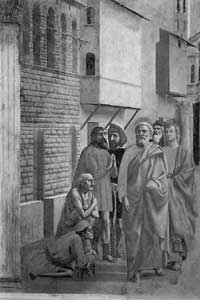 Die
"Schattenheilung" von Masaccio verkehrt ein altes Vorurteil über
den Schatten ins Positive. Schatten gelten uns als Unglücksboten.
Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus. Wer im Schatten steht,
bekommt wenig Licht ab. Das Schattenreich ist eine Unterwelt. Wer dort
ist, existiert nur noch als Schatten seiner selbst. Masaccio ist der erste
Maler, der dem Schatten so positive Seiten abgewinnen kann, dass er ihn
zu einem Thema der Malerei erhebt. Der Schatten als Heilsbringer.
Petrus' Schatten fällt auf den armseligen Krüppel und - heilt
ihn von seinem Leiden. Masaccio heilt damit die Malerei von ihrem Unwissen
über Licht und Schatten. Masaccio interpretiert hier einen Text der
Apostelgeschichte (3,1-26) auf eine sehr eigenwillige
Art und Weise. Dort ist es nämlich das Apostelwort
"Steh auf und
geh umher!", das den Lahmen gehen macht. Den Schatten nimmt sich der
Maler von einer anderen Stelle zu leihen. Die
"Schattenheilung" von Masaccio verkehrt ein altes Vorurteil über
den Schatten ins Positive. Schatten gelten uns als Unglücksboten.
Ein Ereignis wirft seine Schatten voraus. Wer im Schatten steht,
bekommt wenig Licht ab. Das Schattenreich ist eine Unterwelt. Wer dort
ist, existiert nur noch als Schatten seiner selbst. Masaccio ist der erste
Maler, der dem Schatten so positive Seiten abgewinnen kann, dass er ihn
zu einem Thema der Malerei erhebt. Der Schatten als Heilsbringer.
Petrus' Schatten fällt auf den armseligen Krüppel und - heilt
ihn von seinem Leiden. Masaccio heilt damit die Malerei von ihrem Unwissen
über Licht und Schatten. Masaccio interpretiert hier einen Text der
Apostelgeschichte (3,1-26) auf eine sehr eigenwillige
Art und Weise. Dort ist es nämlich das Apostelwort
"Steh auf und
geh umher!", das den Lahmen gehen macht. Den Schatten nimmt sich der
Maler von einer anderen Stelle zu leihen.
Der Kunsterzieher möchte mit diesem Bild seinen Schülern ein Beispiel geben für den neuen Realismus bei Masaccio. Nicht mehr das Licht ist der Heilsbringer, symbolisch als Strahl dargestellt, der aus den Wolken kommt, so wie das das Mittelalter sah, sondern sein ständiger Begleiter, der Schatten. Licht und Schatten stehen nicht mehr für Gut und Böse, sondern für das natürliche Phänomen der Sichtbarkeit. Naturbeobachtung als neues Heil der Welt. Braucht er dazu eigentlich ein Farbbild, oder reicht auch schwarz/weiß? Sind Schatten überhaupt schwarz? |
 Die
Transformation der mit Kalkfarben bemalten Putzschicht in eine mit Silberhalogeniden
beschichteten Folie erlaubt nur die Übertragung ganz bestimmter Informationen
über die Wand. Es sind dies ausschließlich Daten über
die Reflexionsfähigkeit der Wandoberfläche bei einer gegebenen
Beleuchtung, nur ein Schatten des realen Bildes. Die fotografische
Schicht des Films enthält eine hohe Anzahl von 'empfindlichen Meßgeräten'
für direktes oder reflektiertes Licht. Jedes Molekül der Schicht
ist ein solches Meßgerät. Es speichert ein von der Wand reflektiertes
Quantum Licht durch Schwärzung des in ihm gebundenen Silbers. Da alle
Moleküle zur gleichen Zeit und in der gleichen Dauer dem reflektierten
Licht der Wand ausgesetzt sind, entsteht auf dem Film ein den Reflexionseigenschaften
des Freskos analoges Muster, ein fotografisches, mobiles, nach Pfarrkirchen
transportables Bild.
Die
Transformation der mit Kalkfarben bemalten Putzschicht in eine mit Silberhalogeniden
beschichteten Folie erlaubt nur die Übertragung ganz bestimmter Informationen
über die Wand. Es sind dies ausschließlich Daten über
die Reflexionsfähigkeit der Wandoberfläche bei einer gegebenen
Beleuchtung, nur ein Schatten des realen Bildes. Die fotografische
Schicht des Films enthält eine hohe Anzahl von 'empfindlichen Meßgeräten'
für direktes oder reflektiertes Licht. Jedes Molekül der Schicht
ist ein solches Meßgerät. Es speichert ein von der Wand reflektiertes
Quantum Licht durch Schwärzung des in ihm gebundenen Silbers. Da alle
Moleküle zur gleichen Zeit und in der gleichen Dauer dem reflektierten
Licht der Wand ausgesetzt sind, entsteht auf dem Film ein den Reflexionseigenschaften
des Freskos analoges Muster, ein fotografisches, mobiles, nach Pfarrkirchen
transportables Bild.
Der Kunsterzieher wünscht nun den Schülern einen Eindruck von der Größe des Originals zu geben und möchte das Dia durch einen Fotografen auf das Format der Originalwand vergrößern lassen. Der Fotograf rät ab und will den Auftrag nicht annehmen. Was dabei deutlich zum Vorschein käme, sagt er, sind die schwachen Auflösungseigenschaften des Films: Die Körnung des Films, die Unschärfe der Aufnahme, die Oberflächeneigenschaften des Fotopapiers werden wahrnehmbar. Auflösung würde zu einem ästhetischen Phänomen und Störfaktor, für den er nicht verantwortlich sein will.

 Was
bei der Reproduktion von Masaccios Bild stören würde, hilft uns
bei anderen Bildern.
Unschärfe und Detailmangel sind
im fotografischen Bild z.B. ein Kennzeichen für räumliche
Distanz. Manet verwendet das auch in der Malerei, anders als Masaccio,
bei dem das Bild auch in der Tiefe scharf umrissen und detailliert ist.
Manet malt Bildgegenstände des Vordergrunds schärfer und in höherer
Detaillierung = Auflösung, während er den Hintergrund grob und
im Umriß unbestimmt darstellt. Da Manet mit uns in diesem Bild ein
Spielchen mit Entfernungen treibt, trägt die Unschärfe genauso
wie die schwache Auflösung zur 'Klärung' der räumlichen
Situation im Bild bei. Im Vordergrund des Bildes sehen wir die Bardame
von vorne. Sie ist uns nah und deshalb im Umriß scharf
gezeichnet. Der Spiegel im Hintergrund ist nicht viel weiter entfernt,
aber er spiegelt den ganzen Raum mit den Menschen an den Tischen, und die
sind weit entfernt, auch wenn ihr Spiegelbild nahe ist und ein Fotoapparat
leicht auf sie focussieren könnte. Rechts neben der Bardame sehen
wir ihr Spiegelbild also sie von hinten. Da sie nahe am Spiegel steht,
ist ihr Umriß scharf, während der Mann, der sie anschaut und
in Wirklichkeit vor ihr, also näher zu uns steht, vom Spiegel weiter
entfernt ist und deshalb deutlich unschärfer abgebildet
ist. Alles klar?
Was
bei der Reproduktion von Masaccios Bild stören würde, hilft uns
bei anderen Bildern.
Unschärfe und Detailmangel sind
im fotografischen Bild z.B. ein Kennzeichen für räumliche
Distanz. Manet verwendet das auch in der Malerei, anders als Masaccio,
bei dem das Bild auch in der Tiefe scharf umrissen und detailliert ist.
Manet malt Bildgegenstände des Vordergrunds schärfer und in höherer
Detaillierung = Auflösung, während er den Hintergrund grob und
im Umriß unbestimmt darstellt. Da Manet mit uns in diesem Bild ein
Spielchen mit Entfernungen treibt, trägt die Unschärfe genauso
wie die schwache Auflösung zur 'Klärung' der räumlichen
Situation im Bild bei. Im Vordergrund des Bildes sehen wir die Bardame
von vorne. Sie ist uns nah und deshalb im Umriß scharf
gezeichnet. Der Spiegel im Hintergrund ist nicht viel weiter entfernt,
aber er spiegelt den ganzen Raum mit den Menschen an den Tischen, und die
sind weit entfernt, auch wenn ihr Spiegelbild nahe ist und ein Fotoapparat
leicht auf sie focussieren könnte. Rechts neben der Bardame sehen
wir ihr Spiegelbild also sie von hinten. Da sie nahe am Spiegel steht,
ist ihr Umriß scharf, während der Mann, der sie anschaut und
in Wirklichkeit vor ihr, also näher zu uns steht, vom Spiegel weiter
entfernt ist und deshalb deutlich unschärfer abgebildet
ist. Alles klar?
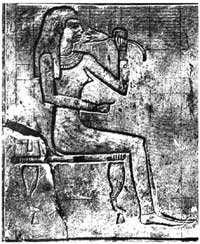 Das
Zerlegen
von Bildern erscheint bereits in archaischer Zeit als eine grundlegende
Technik zum Aufbau und zur Übertragung von Bildern. Der heute übliche
Begriff kommt aus dem Lateinischen. Rastrum ist eine Hacke mit mehreren
Zinken zum Zerkleinern von Erdschollen, also eine Art Rechen. Beim Bildaufbau
dient das Raster dem Zerlegen der Bildfläche in kleinere Portionen
und sodann der Verteilung, Ordnung der Bildgegenstände, Bildelemente
auf der umgrenzten Bildfläche. Bei der Übertragung eines Entwurfs
auf den endgültigen Bildgrund dient es der Herstellung proportionaler
Analogie in Höhe und Breite = geometrischer Ähnlichkeit.
Das
Zerlegen
von Bildern erscheint bereits in archaischer Zeit als eine grundlegende
Technik zum Aufbau und zur Übertragung von Bildern. Der heute übliche
Begriff kommt aus dem Lateinischen. Rastrum ist eine Hacke mit mehreren
Zinken zum Zerkleinern von Erdschollen, also eine Art Rechen. Beim Bildaufbau
dient das Raster dem Zerlegen der Bildfläche in kleinere Portionen
und sodann der Verteilung, Ordnung der Bildgegenstände, Bildelemente
auf der umgrenzten Bildfläche. Bei der Übertragung eines Entwurfs
auf den endgültigen Bildgrund dient es der Herstellung proportionaler
Analogie in Höhe und Breite = geometrischer Ähnlichkeit.
 Bei
den frühen Beispielen des Bildrasters zeigt sich deutlich die Verwandtschaft
von Bildraster und Schriftzeile , welche zur Ordnung von Texten
und zur Ausrichtung von Schriftzeichen seit jeher eine Grundlage darstellt.
Zumindest Bilder, die im Zusammenhang von Texten auftauchen, werden schon
bei den Ägyptern im 3. Jahrtausend vor Christus dem zeilenweisen Aufbau
des Textes unterworfen, wobei Zeile in gleicher Weise horizontale wie vertikale
Linie bedeuten kann. Wenn auch die rasterartige Gliederung der Bildfläche
bei den Ägyptern ein deutlich wahrnehmbares System darstellt, so wurde
vom Maler oder Bildhauer das eigentliche Bildraster lediglich als Hilfsmittel
wie bei einer Vorzeichnung eingesetzt, die letztlich ausgelöscht und
von der sichtbaren Oberfläche verbannt wurde. Allein die zahlreichen
unvollendet gebliebenen Reliefs und Malereien zeigen uns, daß die
klaren geometrischen Absichten nicht spontan entstanden, sondern absichtsvoll
ins Werk gesetzt wurden.
Bei
den frühen Beispielen des Bildrasters zeigt sich deutlich die Verwandtschaft
von Bildraster und Schriftzeile , welche zur Ordnung von Texten
und zur Ausrichtung von Schriftzeichen seit jeher eine Grundlage darstellt.
Zumindest Bilder, die im Zusammenhang von Texten auftauchen, werden schon
bei den Ägyptern im 3. Jahrtausend vor Christus dem zeilenweisen Aufbau
des Textes unterworfen, wobei Zeile in gleicher Weise horizontale wie vertikale
Linie bedeuten kann. Wenn auch die rasterartige Gliederung der Bildfläche
bei den Ägyptern ein deutlich wahrnehmbares System darstellt, so wurde
vom Maler oder Bildhauer das eigentliche Bildraster lediglich als Hilfsmittel
wie bei einer Vorzeichnung eingesetzt, die letztlich ausgelöscht und
von der sichtbaren Oberfläche verbannt wurde. Allein die zahlreichen
unvollendet gebliebenen Reliefs und Malereien zeigen uns, daß die
klaren geometrischen Absichten nicht spontan entstanden, sondern absichtsvoll
ins Werk gesetzt wurden.
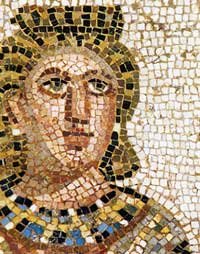
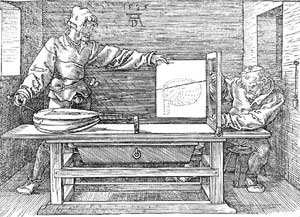 Abb.
4 zeigt in einem Holzschnitt Dürers ein Verfahren zur Konstruktion
des perspektivischen Bilds. Jeder Bildpunkt wird hier mit Hilfe eines Fadens
bestimmt, der die Funktion eines Peilstrahls besitzt. Der Schnittpunkt
von Peilstrahl und Bildebene wird nach seinen Koordinaten bestimmt (das
macht der Mann rechts) und auf die Bildfläche als Punkt übertragen.
Das Bildraster (Koordinatensystem) wird damit zum universellen Instrument
zur Bestimmung der Lage jedes einzelnen Bildpunkts in beliebig hoher Auflösung.
Bezeichnend in diesem Beispiel ist, welche Punkte Dürer seine Gehilfen
übertragen lässt. Im Prinzip wäre jeder Punkt gleich berechtigt.
Der Zeichner allerdings weiß, daß für den Raumeindruck
des Abbilds ganz bestimmte Punkte hinreichend sind. In der Reduktion der
Informationsdichte liegt eine Konzentration aufs Wesentliche.
Abb.
4 zeigt in einem Holzschnitt Dürers ein Verfahren zur Konstruktion
des perspektivischen Bilds. Jeder Bildpunkt wird hier mit Hilfe eines Fadens
bestimmt, der die Funktion eines Peilstrahls besitzt. Der Schnittpunkt
von Peilstrahl und Bildebene wird nach seinen Koordinaten bestimmt (das
macht der Mann rechts) und auf die Bildfläche als Punkt übertragen.
Das Bildraster (Koordinatensystem) wird damit zum universellen Instrument
zur Bestimmung der Lage jedes einzelnen Bildpunkts in beliebig hoher Auflösung.
Bezeichnend in diesem Beispiel ist, welche Punkte Dürer seine Gehilfen
übertragen lässt. Im Prinzip wäre jeder Punkt gleich berechtigt.
Der Zeichner allerdings weiß, daß für den Raumeindruck
des Abbilds ganz bestimmte Punkte hinreichend sind. In der Reduktion der
Informationsdichte liegt eine Konzentration aufs Wesentliche. Historisches
Historisches
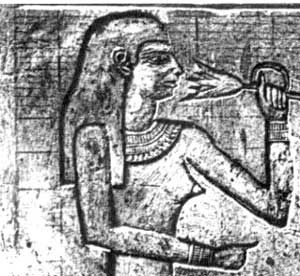 Am differenziertesten hat sich dieses Prinzip in der Notenschrift gehalten.
Am differenziertesten hat sich dieses Prinzip in der Notenschrift gehalten.
 Schließlich sind es die Schnittpunkte von Rasterlinien und Formlinien
, die in einer sinnvollen Dichte erzeugt werden müssen.
Schließlich sind es die Schnittpunkte von Rasterlinien und Formlinien
, die in einer sinnvollen Dichte erzeugt werden müssen.
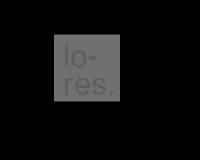 Das
Pixel ist dem Bildinhalt gegenüber völlig gleichgültig.
Es reduziert jede beliebige Bildstelle auf einen bestimmten Wert einer
Tonskala, z.B. Schwarz-Weiß. Dabei wächst auf eigenartige Weise
mit zunehmender Auflösung (= Verkleinerung der Pixel) und einer
gleichbleibenden Anzahl von Graustufen (Voraussetzung ist ein Minimum von
16 Grauwerten), die Fähigkeit der Picture Elements im Verbund mit
ihrer Vielzahl eine ganze Bandbreite wünschenswerter Bildinformationen
zu übermitteln. Anders gesagt: Die durch das Bild übermittelte
Informationsdichte
über die Helldunkel-Beschaffenheit eines Objekts ist ein ganz wesentlicher
Parameter für die Interpretation zahlreicher Objekteigenschaften
wie Form, Raumausdehnung, Oberflächenbeschaffenheit, Materialeigenschaften,
Reflexionseigenschaften. Im Gegensatz zum Pixel des Bildschirms, das auf
eine ganze Skala von Grautönen zurückgreifen kann, erzeugt
das druckgrafische Raster seine Halbtöne aus dem Zusammenspiel nur
einer
Druckfarbe und einem Farbton des bedruckten Papiers oder Stoffs. Die
Animation zeigt eine stufenweise Verkleinerung der Pixelgröße
bei einer möglichen Anzahl von 32 Graustufen.
Das
Pixel ist dem Bildinhalt gegenüber völlig gleichgültig.
Es reduziert jede beliebige Bildstelle auf einen bestimmten Wert einer
Tonskala, z.B. Schwarz-Weiß. Dabei wächst auf eigenartige Weise
mit zunehmender Auflösung (= Verkleinerung der Pixel) und einer
gleichbleibenden Anzahl von Graustufen (Voraussetzung ist ein Minimum von
16 Grauwerten), die Fähigkeit der Picture Elements im Verbund mit
ihrer Vielzahl eine ganze Bandbreite wünschenswerter Bildinformationen
zu übermitteln. Anders gesagt: Die durch das Bild übermittelte
Informationsdichte
über die Helldunkel-Beschaffenheit eines Objekts ist ein ganz wesentlicher
Parameter für die Interpretation zahlreicher Objekteigenschaften
wie Form, Raumausdehnung, Oberflächenbeschaffenheit, Materialeigenschaften,
Reflexionseigenschaften. Im Gegensatz zum Pixel des Bildschirms, das auf
eine ganze Skala von Grautönen zurückgreifen kann, erzeugt
das druckgrafische Raster seine Halbtöne aus dem Zusammenspiel nur
einer
Druckfarbe und einem Farbton des bedruckten Papiers oder Stoffs. Die
Animation zeigt eine stufenweise Verkleinerung der Pixelgröße
bei einer möglichen Anzahl von 32 Graustufen.  Gibt
es eine Lösung ohne den Punkt?
Gibt
es eine Lösung ohne den Punkt?
 Große
Liniendichten erzeugen auf hellem Grund den Eindruck von Dunkelheit. Durch
Verdichtung der Linien entsteht der Eindruck von Tönen zwischen der
schwarzen Druckfarbe und dem weißen Papiergrund. Dabei eignet sich
das Material Holz nur für einen geringen Umfang an Tonwerten, während
der Kupferstich, dank des härteren Materials eine feinere Lineatur
und damit eine feinere Abstufung der Halbtöne zuläßt. Was
ein Virtuose allerdings aus seinem Handwerk herausholen kann, das verdient
uneingeschränkte Bewunderung. Erst die Vergrößerung macht
die Raffinessen sichtbar.
Große
Liniendichten erzeugen auf hellem Grund den Eindruck von Dunkelheit. Durch
Verdichtung der Linien entsteht der Eindruck von Tönen zwischen der
schwarzen Druckfarbe und dem weißen Papiergrund. Dabei eignet sich
das Material Holz nur für einen geringen Umfang an Tonwerten, während
der Kupferstich, dank des härteren Materials eine feinere Lineatur
und damit eine feinere Abstufung der Halbtöne zuläßt. Was
ein Virtuose allerdings aus seinem Handwerk herausholen kann, das verdient
uneingeschränkte Bewunderung. Erst die Vergrößerung macht
die Raffinessen sichtbar.
 1516
sucht in Venedig ein Holzschneider um Erteilung eines Privilegs nach. Wir
würden heute sagen, er meldet ein Patent an. Ugo da Carpi gilt
damit in Italien als Erfinder des Helldunkel-Drucks. In Deutschland
datiert man einen Holzschnitt nach diesem Verfahren bereits auf
1509. Lucas Cranach ist der Autor. Vermutlich reagiert der Italiener
mit seinem Wunsch nach einem Privileg auf die Konkurrenz, die ihm in den
letzten Jahren aus Deutschland erwächst. Seine Drucke kommen einer
Malerei durch Verwendung von Farbe erheblich näher als die üblichen
Holzschnitte, die man zur Aufwertung gelegentlich per Hand kolorierte.
Neben der schwarzen Druckplatte erzeugt Carpi mit einer braunen Tonplatte
eine deutlich malerischere Wirkung. Ugo da Carpi hat Drucke mit bis zu
vier Tonplatten hergestellt. Ein mühsamer Weg, um Farbe ins Bild zu
bringen, denn für jeden Farbton mußte ein eigener Druckstock
geschnitten werden und jede zusätzliche Farbe bedeutet einen weiteren
Druckgang.
1516
sucht in Venedig ein Holzschneider um Erteilung eines Privilegs nach. Wir
würden heute sagen, er meldet ein Patent an. Ugo da Carpi gilt
damit in Italien als Erfinder des Helldunkel-Drucks. In Deutschland
datiert man einen Holzschnitt nach diesem Verfahren bereits auf
1509. Lucas Cranach ist der Autor. Vermutlich reagiert der Italiener
mit seinem Wunsch nach einem Privileg auf die Konkurrenz, die ihm in den
letzten Jahren aus Deutschland erwächst. Seine Drucke kommen einer
Malerei durch Verwendung von Farbe erheblich näher als die üblichen
Holzschnitte, die man zur Aufwertung gelegentlich per Hand kolorierte.
Neben der schwarzen Druckplatte erzeugt Carpi mit einer braunen Tonplatte
eine deutlich malerischere Wirkung. Ugo da Carpi hat Drucke mit bis zu
vier Tonplatten hergestellt. Ein mühsamer Weg, um Farbe ins Bild zu
bringen, denn für jeden Farbton mußte ein eigener Druckstock
geschnitten werden und jede zusätzliche Farbe bedeutet einen weiteren
Druckgang.
 Wir
haben bei Dürer gesehen, dass der Holzschnitt um 1500 herum erheblich
an Auflösungsvermögen gewinnt. Ich vermute, dass dies auch mit
der Konkurrenz durch ein neues Druckverfahren zu tun hat. Der Kupferstich
löst den Holzschnitt ab, weil Künstler und Publikum einen
höheren Bedarf nach Detailreichtum und Realistik haben. Der
Kupferstich von Raimondi nach einem Bild von Raffael ("Urteil des
Paris") zeigt das Anforderungsniveau, das man um 1500 unter Kennern an
einen Reproduktionsstich haben konnte. Bei einer Größe von ca
40 x 30 cm weist er eine hohe Liniendichte und damit einen Reichtum an
Tonwerten im Bereich Helldunkel auf, den der Holzschnitt so nicht bieten
kann. Wir kennen dieselbe Entwicklung aus jüngster Vergangenheit mit
der Bildschirmdarstellung. Wer würde sich heute noch mit einer Auflösung
von 230 x 256 und 32 Graustufen zufrieden geben. Vor 10 Jahren war das
das Grafikformat, in dem wir die meisten Computeranimationen gemacht haben.
Die PCs in unserem schulischen Rechnerraum hatten damals noch überhaupt
keine Farbe, der Amiga hatte schon 256! Damit kann man Schüler heute
nicht mehr locken.
Wir
haben bei Dürer gesehen, dass der Holzschnitt um 1500 herum erheblich
an Auflösungsvermögen gewinnt. Ich vermute, dass dies auch mit
der Konkurrenz durch ein neues Druckverfahren zu tun hat. Der Kupferstich
löst den Holzschnitt ab, weil Künstler und Publikum einen
höheren Bedarf nach Detailreichtum und Realistik haben. Der
Kupferstich von Raimondi nach einem Bild von Raffael ("Urteil des
Paris") zeigt das Anforderungsniveau, das man um 1500 unter Kennern an
einen Reproduktionsstich haben konnte. Bei einer Größe von ca
40 x 30 cm weist er eine hohe Liniendichte und damit einen Reichtum an
Tonwerten im Bereich Helldunkel auf, den der Holzschnitt so nicht bieten
kann. Wir kennen dieselbe Entwicklung aus jüngster Vergangenheit mit
der Bildschirmdarstellung. Wer würde sich heute noch mit einer Auflösung
von 230 x 256 und 32 Graustufen zufrieden geben. Vor 10 Jahren war das
das Grafikformat, in dem wir die meisten Computeranimationen gemacht haben.
Die PCs in unserem schulischen Rechnerraum hatten damals noch überhaupt
keine Farbe, der Amiga hatte schon 256! Damit kann man Schüler heute
nicht mehr locken.
 Der
Kupferstich lieferte, wonach das Publikum seit dem Ende des 16. Jhs. zunehmend
verlangte, ein differenziertes Helldunkel, zunächst allerdings in
der Hauptsache mit Hilfe feinster Linien, Schraffuren. Einfacher als beim
Holzschnitt fällt im Kupferstich das Erzeugen einer an- und abschwellenden
Linie, wie man sie von der Federzeichnung her kennt. Darin enthalten ist
die Möglichkeit, weiche, fließende Übergänge von Hell
nach Dunkel zu erzeugen. In der hier gezeigten Vergrößerung
einer Schraffur mit taillierter Linie wird schon das Bedürfnis
nach dem Punkt sichtbar. Der Stecher hat in jeden Zwischenraum der Kreuzschraffur
noch einen Punkt gesetzt, und damit den stofflich harten Eindruck etwas
abgemildert. Damit sind wir bei unserem Ausflug über die Linie nun
fast schon am Punkt angelangt.
Der
Kupferstich lieferte, wonach das Publikum seit dem Ende des 16. Jhs. zunehmend
verlangte, ein differenziertes Helldunkel, zunächst allerdings in
der Hauptsache mit Hilfe feinster Linien, Schraffuren. Einfacher als beim
Holzschnitt fällt im Kupferstich das Erzeugen einer an- und abschwellenden
Linie, wie man sie von der Federzeichnung her kennt. Darin enthalten ist
die Möglichkeit, weiche, fließende Übergänge von Hell
nach Dunkel zu erzeugen. In der hier gezeigten Vergrößerung
einer Schraffur mit taillierter Linie wird schon das Bedürfnis
nach dem Punkt sichtbar. Der Stecher hat in jeden Zwischenraum der Kreuzschraffur
noch einen Punkt gesetzt, und damit den stofflich harten Eindruck etwas
abgemildert. Damit sind wir bei unserem Ausflug über die Linie nun
fast schon am Punkt angelangt.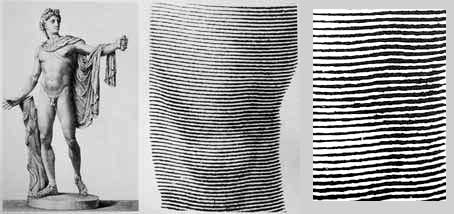 Nochmal
von vorne: Wie kann man in einem Druckgang und mit einer Farbe ein Bild
drucken, das über eine ganze Skala von Halbtönen verfügt?
Nochmal
von vorne: Wie kann man in einem Druckgang und mit einer Farbe ein Bild
drucken, das über eine ganze Skala von Halbtönen verfügt?
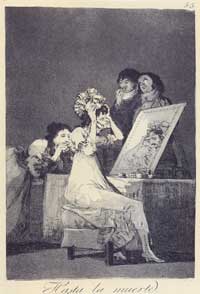
 1642
erfindet Ludwig von Siegen die Technik des Mezzotinto (das
heißt so viel wie 'Halbton'). Koschatzky nennt ihn einen Amateur,
der Brockhaus kennt ihn nicht einmal. Immerhin schafft es dieser Freizeitkünstler,
die
bisher in der Druckgrafik dominante Linie durch den Punkt abzulösen.
Dies ist ein ganz entscheidender Schritt in Richtung einer erhöhten
Informationsdichte in der Druckgrafik. Außerdem schafft der Punkt
als Darstellungsmittel eine einheitliche und gegenüber subjektivem
Ausdruck neutrale Bildstruktur, die in ihrem zeilenweisen und mechanischen
Aufbau die Grundidee eines maschinellen und technischen Bildverfahrens
vorwegnimmt. Mezzotinto ist ein Verfahren des Kupferstichs und damit ein
Tiefdruck. Beim Tiefdruck werden einer polierten Metallplatte mit einem
scharf geschliffenen Stahlstichel Verletzungen beigebracht, aus denen heraus
der Druck erfolgt. Anders als beim Hochdruck bleibt die druckende Linie
also nicht stehen, sondern wird entfernt. In den Vertiefungen fängt
sich die Druckfarbe, die polierte Oberfläche druckt nicht (kaum) ab.
Ludwig von Siegen hat erst einmal eine Kupferplatte hergestellt, von der
man einen gleichmäßigen Schwarzton hätte drucken können.
Er hat das erreicht, indem er mit einem rechenartigen Stahl, einem "Wiegemesser",
kreuz und quer und in großer Dichte punktförmige Vertiefungen
in die Kupferplatte eingedrückt hat. Eine äußerst mühsame
Arbeit, Koschatzky spricht von drei Wochen Vorbereitungszeit! Die "Zeichnung
entsteht dann dadurch, daß mit einem Polierstahl durch Drücken
und Schaben die aufgerauhte Fläche dort geglättet wird, wo der
Druckton heller werden soll. An den lichten Stellen muß die Platte
glatt poliert werden, was nur bei dem relativ weichen Kupfer gelingt. "Schabkunst"
heißt das Verfahren deshalb auch.
1642
erfindet Ludwig von Siegen die Technik des Mezzotinto (das
heißt so viel wie 'Halbton'). Koschatzky nennt ihn einen Amateur,
der Brockhaus kennt ihn nicht einmal. Immerhin schafft es dieser Freizeitkünstler,
die
bisher in der Druckgrafik dominante Linie durch den Punkt abzulösen.
Dies ist ein ganz entscheidender Schritt in Richtung einer erhöhten
Informationsdichte in der Druckgrafik. Außerdem schafft der Punkt
als Darstellungsmittel eine einheitliche und gegenüber subjektivem
Ausdruck neutrale Bildstruktur, die in ihrem zeilenweisen und mechanischen
Aufbau die Grundidee eines maschinellen und technischen Bildverfahrens
vorwegnimmt. Mezzotinto ist ein Verfahren des Kupferstichs und damit ein
Tiefdruck. Beim Tiefdruck werden einer polierten Metallplatte mit einem
scharf geschliffenen Stahlstichel Verletzungen beigebracht, aus denen heraus
der Druck erfolgt. Anders als beim Hochdruck bleibt die druckende Linie
also nicht stehen, sondern wird entfernt. In den Vertiefungen fängt
sich die Druckfarbe, die polierte Oberfläche druckt nicht (kaum) ab.
Ludwig von Siegen hat erst einmal eine Kupferplatte hergestellt, von der
man einen gleichmäßigen Schwarzton hätte drucken können.
Er hat das erreicht, indem er mit einem rechenartigen Stahl, einem "Wiegemesser",
kreuz und quer und in großer Dichte punktförmige Vertiefungen
in die Kupferplatte eingedrückt hat. Eine äußerst mühsame
Arbeit, Koschatzky spricht von drei Wochen Vorbereitungszeit! Die "Zeichnung
entsteht dann dadurch, daß mit einem Polierstahl durch Drücken
und Schaben die aufgerauhte Fläche dort geglättet wird, wo der
Druckton heller werden soll. An den lichten Stellen muß die Platte
glatt poliert werden, was nur bei dem relativ weichen Kupfer gelingt. "Schabkunst"
heißt das Verfahren deshalb auch.
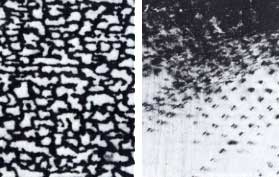 Die zwischen den Körnern frei bleibende Metallfläche wird beim
Ätzbad durch Säure angegeriffen und aufgerauht, sodass sie Druckfarbe
beim Einfärben aufnimmt. Rechts die Spuren eines Wiegestahls
auf Kupfer. In den Vertiefungen bleibt beim Einfärben der Platte die
Farbe liegen, von der glatten Oberfläche wird sie wieder weggewischt.
Die zwischen den Körnern frei bleibende Metallfläche wird beim
Ätzbad durch Säure angegeriffen und aufgerauht, sodass sie Druckfarbe
beim Einfärben aufnimmt. Rechts die Spuren eines Wiegestahls
auf Kupfer. In den Vertiefungen bleibt beim Einfärben der Platte die
Farbe liegen, von der glatten Oberfläche wird sie wieder weggewischt.
 Unsere
von der Bildschirmdarstellung geprägte Vorstellung vom Pixel hat einen
unmittelbaren Vorfahren im Rasterpunkt der Autotypie (Selbstdruck).
Alle Drucksachen, die uns heute bunt und in hoher Auflösung ins Haus
flattern, haben im Prinzip denselben Aufbau aus Rasterpunkten, meist
in vier Farben. Diese Erfindung geht zurück auf Georg Meisenbach,
Kupferstecher aus München. 1881 hat er die Autotypie als Druckverfahren
zum Patent angemeldet. Dabei ist seine Erfindung alles andere als die Tat
eines Einzelgängers. Zahllose Schritte gehen seiner Erfindung voraus
und folgen ihr bis in jüngste Vergangenheit. Seit Erfindung der Fotografie
arbeiten zahllose Tüftler an Verfahren der fotomechanischen Herstellung
von Druckplatten. Schon bei Talbot taucht die Idee auf "daß
man durch Benutzung eines Gewebes ein Halbtonbild aufteilen und zur Druckplattenätzung
brauchbar machen kann"
Unsere
von der Bildschirmdarstellung geprägte Vorstellung vom Pixel hat einen
unmittelbaren Vorfahren im Rasterpunkt der Autotypie (Selbstdruck).
Alle Drucksachen, die uns heute bunt und in hoher Auflösung ins Haus
flattern, haben im Prinzip denselben Aufbau aus Rasterpunkten, meist
in vier Farben. Diese Erfindung geht zurück auf Georg Meisenbach,
Kupferstecher aus München. 1881 hat er die Autotypie als Druckverfahren
zum Patent angemeldet. Dabei ist seine Erfindung alles andere als die Tat
eines Einzelgängers. Zahllose Schritte gehen seiner Erfindung voraus
und folgen ihr bis in jüngste Vergangenheit. Seit Erfindung der Fotografie
arbeiten zahllose Tüftler an Verfahren der fotomechanischen Herstellung
von Druckplatten. Schon bei Talbot taucht die Idee auf "daß
man durch Benutzung eines Gewebes ein Halbtonbild aufteilen und zur Druckplattenätzung
brauchbar machen kann"

 Die
Autotypie löst im Bilddruck die traditionellen Verfahren des Kupferstichs
und Holzschnitts ab. Direkter Vorläufer war der Holzstich,
auch genannt Xylographie. Erfinder des Holzstichs ist der Engländer
Thomas
Bewick. Ein Datum oder Patent für diese Erfindung scheint es nicht
zu geben, aber sie fällt wohl noch ins 18. Jh. Wie kann man in
Holz so feine Linien schneiden? Bewick war klar, daß die Verfeinerung
des Holzschnitts nur über ein möglichst hartes und feinfaseriges
Material möglich sein würde. Er verwendete das extrem langsam
wachsende Holz des Buchsbaums und er stellte das Brett nicht durch Längsschnitt,
sondern durch Quer zum Wachstum geschnittenes Holz, Hirnholz, her. Für
ein Brett müssen dazu viele Leisten verleimt und glatt geschliffen
werden. Schließlich bearbeitete er das Brett nicht mit dem Messer,
sondern dem Stichel, einem kantig geschliffenen Stahl, wie er auch zum
Kupferstich gebraucht wird. Dadurch bilden die Linien ein so dichtes Netz,
daß sie dem Betrachter nicht mehr als Linien, sondern als Tonfläche
erscheinen. Der Holzstich ist eine hochgradig verfeinerte, manuelle Kunstfertigkeit,
die den Spezialisten erfordert. In der Literatur wird unterschieden zwischen
dem Faksimileholzstich, bei dem sich die schwarzen Linien überschneiden,
und dem Tonholzstich , bei dem sich die weißen Linien kreuzen.
Demnach zeigt die Abbildung einen Tonholzstich. Der Stecher hat sich zudem
die Fotografie zur Hilfe genommen und seine Vorlage auf fotografischem
Weg auf den Druckstock übertragen. Fotoxylografie nennt sich das dann.
Die Xylografie ist ein Hochdruckverfahren und hatte im Buchdruck den Vorteil,
dass Text und Bild in einem Zug abgedruckt werden konnten.
Die
Autotypie löst im Bilddruck die traditionellen Verfahren des Kupferstichs
und Holzschnitts ab. Direkter Vorläufer war der Holzstich,
auch genannt Xylographie. Erfinder des Holzstichs ist der Engländer
Thomas
Bewick. Ein Datum oder Patent für diese Erfindung scheint es nicht
zu geben, aber sie fällt wohl noch ins 18. Jh. Wie kann man in
Holz so feine Linien schneiden? Bewick war klar, daß die Verfeinerung
des Holzschnitts nur über ein möglichst hartes und feinfaseriges
Material möglich sein würde. Er verwendete das extrem langsam
wachsende Holz des Buchsbaums und er stellte das Brett nicht durch Längsschnitt,
sondern durch Quer zum Wachstum geschnittenes Holz, Hirnholz, her. Für
ein Brett müssen dazu viele Leisten verleimt und glatt geschliffen
werden. Schließlich bearbeitete er das Brett nicht mit dem Messer,
sondern dem Stichel, einem kantig geschliffenen Stahl, wie er auch zum
Kupferstich gebraucht wird. Dadurch bilden die Linien ein so dichtes Netz,
daß sie dem Betrachter nicht mehr als Linien, sondern als Tonfläche
erscheinen. Der Holzstich ist eine hochgradig verfeinerte, manuelle Kunstfertigkeit,
die den Spezialisten erfordert. In der Literatur wird unterschieden zwischen
dem Faksimileholzstich, bei dem sich die schwarzen Linien überschneiden,
und dem Tonholzstich , bei dem sich die weißen Linien kreuzen.
Demnach zeigt die Abbildung einen Tonholzstich. Der Stecher hat sich zudem
die Fotografie zur Hilfe genommen und seine Vorlage auf fotografischem
Weg auf den Druckstock übertragen. Fotoxylografie nennt sich das dann.
Die Xylografie ist ein Hochdruckverfahren und hatte im Buchdruck den Vorteil,
dass Text und Bild in einem Zug abgedruckt werden konnten. Ein
eigenartiger Zwiespalt existiert zwischen der Bereitschaft das Schraffieren
zu erlernen und dem sinnlichen Reiz, den stufenlos verfließende Farben
oder weiche Helldunkel Verläufe auf Jugendliche ausüben. So stellen
mit der Airbrush erzeugte Bilder für Jugendliche einen außerordentlichen
Anreiz dar, auch wenn sie für uns noch so scheußlich sein mögen.
Wenn man Schülern zeigt, wie sie beispielsweise in Photoshop Verläufe
erzeugen können, kann man einige immer richtiggehend beglücken.
Ähnliche Erfahrungen habe ich mit Fotografie gemacht. Simple Fotogramme
gewinnen ästhetisch in den Augen der Schüler ungemein durch ein
differenziertes Helldunkel, das man einfach durch Belichten, Schablonieren,
Abwedeln erzeugt. Die seit dem Expressionismus in der Kunst so verpönte
maschinelle Ästhetik hat im Alltag eine außerordentlich hohe
Bedeutung. Ein Blick ins Internet zeigt, daß auch beim Gestalten
von Bildschirmseiten der Verlauf von Farben eines der wichtigsten Gestaltungselemente
darstellt. Der Verlauf ist eine Zwischenwelt, ein Schwebezustand, den ich
vergleichen möchte mit anderen Schwebezuständen, dem Anschwellen
und Verklingen eines musikalischen Tons (Sustinato), dem Vor-Sich-Hin-Dösen
im Lateinunterricht. Im Traum oder im Rausch gibt es solche Schwebezustände
und sie berühren uns gefühlsmäßig sanft, tun nicht
weh. Ich halte es für pädagogisch klug, den Schülern Werkzeuge
in die Hand zu geben, mit denen sie ihre Gefühlslagen zum Ausdruck
bringen können. Der Tonverlauf scheint mir dabei ein ganz wesentliches
Mittel.
Ein
eigenartiger Zwiespalt existiert zwischen der Bereitschaft das Schraffieren
zu erlernen und dem sinnlichen Reiz, den stufenlos verfließende Farben
oder weiche Helldunkel Verläufe auf Jugendliche ausüben. So stellen
mit der Airbrush erzeugte Bilder für Jugendliche einen außerordentlichen
Anreiz dar, auch wenn sie für uns noch so scheußlich sein mögen.
Wenn man Schülern zeigt, wie sie beispielsweise in Photoshop Verläufe
erzeugen können, kann man einige immer richtiggehend beglücken.
Ähnliche Erfahrungen habe ich mit Fotografie gemacht. Simple Fotogramme
gewinnen ästhetisch in den Augen der Schüler ungemein durch ein
differenziertes Helldunkel, das man einfach durch Belichten, Schablonieren,
Abwedeln erzeugt. Die seit dem Expressionismus in der Kunst so verpönte
maschinelle Ästhetik hat im Alltag eine außerordentlich hohe
Bedeutung. Ein Blick ins Internet zeigt, daß auch beim Gestalten
von Bildschirmseiten der Verlauf von Farben eines der wichtigsten Gestaltungselemente
darstellt. Der Verlauf ist eine Zwischenwelt, ein Schwebezustand, den ich
vergleichen möchte mit anderen Schwebezuständen, dem Anschwellen
und Verklingen eines musikalischen Tons (Sustinato), dem Vor-Sich-Hin-Dösen
im Lateinunterricht. Im Traum oder im Rausch gibt es solche Schwebezustände
und sie berühren uns gefühlsmäßig sanft, tun nicht
weh. Ich halte es für pädagogisch klug, den Schülern Werkzeuge
in die Hand zu geben, mit denen sie ihre Gefühlslagen zum Ausdruck
bringen können. Der Tonverlauf scheint mir dabei ein ganz wesentliches
Mittel. Die
Abb. zeigt eine Rasterfotografie mit grobem Raster. Der Kopf der
Frau vorne im Bild ist gerade mal mit ca 16 Punkten dargestellt. Das erlaubt
keine Wiedergabe plastischer oder gar stofflicher Eigenschaften. Dennoch
reicht die Auflösung aus, um die Situation einigermaßen einschätzen
zu können. Die Rasterpunkte besitzen unterschiedliche Größe
und Flächendeckung bezogen auf die immer gleiche Fläche des Bedruckstoffs.
Aus dem Zusammenspiel von Punktgröße und unbedrucktem Grund
entsteht der Eindruck von bestimmter Helligkeit an jeder Stelle des Bildes.
Man erkennt deutlich die Umrisse von Personen und Gebäuden und kann
die Tiefenstaffelung des Raums gut abschätzen. Je geringer wir auf
die Bildebene und das Punktmuster focussieren (Leseabstand vergrößern,
Augen zukneifen), desto günstiger ist das für die Lesbarkeit.
Die
Reduktion von Sehschärfe und Helligkeitsaufnahme unseres Auges erzeugt
eine Steigerung in Bezug auf die Lesbarkeit des Abbildungsinhalts.
Die
Abb. zeigt eine Rasterfotografie mit grobem Raster. Der Kopf der
Frau vorne im Bild ist gerade mal mit ca 16 Punkten dargestellt. Das erlaubt
keine Wiedergabe plastischer oder gar stofflicher Eigenschaften. Dennoch
reicht die Auflösung aus, um die Situation einigermaßen einschätzen
zu können. Die Rasterpunkte besitzen unterschiedliche Größe
und Flächendeckung bezogen auf die immer gleiche Fläche des Bedruckstoffs.
Aus dem Zusammenspiel von Punktgröße und unbedrucktem Grund
entsteht der Eindruck von bestimmter Helligkeit an jeder Stelle des Bildes.
Man erkennt deutlich die Umrisse von Personen und Gebäuden und kann
die Tiefenstaffelung des Raums gut abschätzen. Je geringer wir auf
die Bildebene und das Punktmuster focussieren (Leseabstand vergrößern,
Augen zukneifen), desto günstiger ist das für die Lesbarkeit.
Die
Reduktion von Sehschärfe und Helligkeitsaufnahme unseres Auges erzeugt
eine Steigerung in Bezug auf die Lesbarkeit des Abbildungsinhalts.
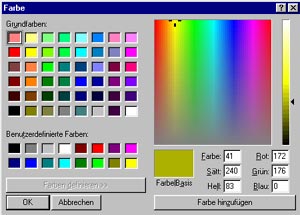 Bezüglich
der Farbe eines Bilds bedeutet Auflösung die Anzahl der Farbinformationen,
die pro Pixel zur Verfügung stehen. Man spricht von Farbtiefe.
Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 1 Bit hat nur zwei mögliche Werte,
z. B. Schwarz oder Weiß. Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 8 Bit
aufgelöst, besitzt schon 28 oder 256 mögliche Werte.
Eine Auflösung von 24 Bit verfügt schon über eine Palette
von 224 oder ca 16 Millionen Farbtönen. Dabei werden die
drei Grundfarben (RGB) mit je 8 Bit aufgelöst. Das Bild zeigt den
Farbeinsteller des Netscape Composer. Er unterscheidet den Farbwert
im Sprektrum nach 240 Positionen. Eingestellt ist gerade Position 41. Sie
liegt im gelben Bereich. Bei der Farbreinheit = Sättigung unterscheidet
er 240 Stufen, eingestellt ist er auf volle Sättigung des gelben Tons
mit der Nr. 41. Auch in der Helligkeit kann er 240 Stufen unterscheiden;
im Regler ganz rechts eingestellt ist der Wert 83. Für Die Grundfarben
Rot,
Grün
und Blau stehen je 256 Stufen = 8 Bit zur Verfügung. Der gewählte
Gelbton enthält 0 Blau, für Grün den Wert 176 und für
Rot den Wert 172.
Bezüglich
der Farbe eines Bilds bedeutet Auflösung die Anzahl der Farbinformationen,
die pro Pixel zur Verfügung stehen. Man spricht von Farbtiefe.
Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 1 Bit hat nur zwei mögliche Werte,
z. B. Schwarz oder Weiß. Ein Pixel mit einer Farbtiefe von 8 Bit
aufgelöst, besitzt schon 28 oder 256 mögliche Werte.
Eine Auflösung von 24 Bit verfügt schon über eine Palette
von 224 oder ca 16 Millionen Farbtönen. Dabei werden die
drei Grundfarben (RGB) mit je 8 Bit aufgelöst. Das Bild zeigt den
Farbeinsteller des Netscape Composer. Er unterscheidet den Farbwert
im Sprektrum nach 240 Positionen. Eingestellt ist gerade Position 41. Sie
liegt im gelben Bereich. Bei der Farbreinheit = Sättigung unterscheidet
er 240 Stufen, eingestellt ist er auf volle Sättigung des gelben Tons
mit der Nr. 41. Auch in der Helligkeit kann er 240 Stufen unterscheiden;
im Regler ganz rechts eingestellt ist der Wert 83. Für Die Grundfarben
Rot,
Grün
und Blau stehen je 256 Stufen = 8 Bit zur Verfügung. Der gewählte
Gelbton enthält 0 Blau, für Grün den Wert 176 und für
Rot den Wert 172.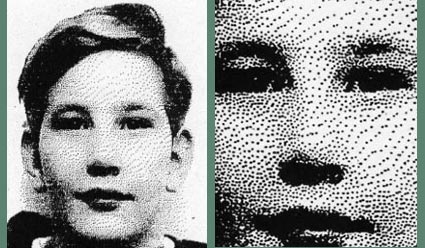 Im
Gegensatz zur systematischen Verteilung der Rasterpunkte beim fotobasierten
Druck setzt der Tintenstrahldrucker auf eine 'unsystematische' Verteilung
von Punkten: 'Error Diffusion'. Zur Veranschaulichung habe ich einen
'Grauwerteausdruck' mit dem Kopierer so stark vergrößert,
daß die Punktverteilung des Druckers deutlich lesbar wurde. In den
dunklen Partien schließen sich die Punkte zu flächendeckenden
Zonen zusammen. Die hellen Partien an der Stirn und im Hintergrund bleiben
frei von Punkten. Die Zonen mittlerer Helligkeit sind von Punkten überzogen,
die in Größe und Form unterschiedlich sind und über ihre
unterschiedliche Dichte zusammen mit dem weißen Papierton unserem
Auge die Halbtöne vermitteln, die wir von fotografischen Bildern und
ihren Abkömmlingen her kennen, und die sich als Lichter und Körperschatten
lesen lassen. Andererseits liegt in der Verteilung der Punkte auch eine
Perspektivische
Wirkung. So bilden die Punkte etwa auf der rechten Backe mehr oder
weniger deutliche diagonale Linien mit variablem Abstand. Dass sich diese
Abstände gerade im mittleren Bereich der Backe weiten, hinterlässt
den Eindruck plastischer Formgebung, Wölbung, genauso, wie man
im Bereich Nasenwinkel / Lippe die Verengung der Linien als plastische
Vertiefung sieht. Auch die Verdichtung der Punkte auf der linken Seite
des Nasenrückens vermittelt eine perspektivische Wirkung: eine mit
Punkten gleichmäßig bedeckte Fläche würde, aus einem
steilen Winkel betrachtet, die Punkte auf der Fläche zusammenrücken
lassen. Helldunkel und Punktstruktur dieses Bildes enthalten also auch
Informationen über das Wölbungsverhalten des plastischen Körpers
Kopf.
Im
Gegensatz zur systematischen Verteilung der Rasterpunkte beim fotobasierten
Druck setzt der Tintenstrahldrucker auf eine 'unsystematische' Verteilung
von Punkten: 'Error Diffusion'. Zur Veranschaulichung habe ich einen
'Grauwerteausdruck' mit dem Kopierer so stark vergrößert,
daß die Punktverteilung des Druckers deutlich lesbar wurde. In den
dunklen Partien schließen sich die Punkte zu flächendeckenden
Zonen zusammen. Die hellen Partien an der Stirn und im Hintergrund bleiben
frei von Punkten. Die Zonen mittlerer Helligkeit sind von Punkten überzogen,
die in Größe und Form unterschiedlich sind und über ihre
unterschiedliche Dichte zusammen mit dem weißen Papierton unserem
Auge die Halbtöne vermitteln, die wir von fotografischen Bildern und
ihren Abkömmlingen her kennen, und die sich als Lichter und Körperschatten
lesen lassen. Andererseits liegt in der Verteilung der Punkte auch eine
Perspektivische
Wirkung. So bilden die Punkte etwa auf der rechten Backe mehr oder
weniger deutliche diagonale Linien mit variablem Abstand. Dass sich diese
Abstände gerade im mittleren Bereich der Backe weiten, hinterlässt
den Eindruck plastischer Formgebung, Wölbung, genauso, wie man
im Bereich Nasenwinkel / Lippe die Verengung der Linien als plastische
Vertiefung sieht. Auch die Verdichtung der Punkte auf der linken Seite
des Nasenrückens vermittelt eine perspektivische Wirkung: eine mit
Punkten gleichmäßig bedeckte Fläche würde, aus einem
steilen Winkel betrachtet, die Punkte auf der Fläche zusammenrücken
lassen. Helldunkel und Punktstruktur dieses Bildes enthalten also auch
Informationen über das Wölbungsverhalten des plastischen Körpers
Kopf.
 Etwa
zeitgleich mit Meisenbach entwickelt Seurat eine neoimpressionistische
Malerei, die auf der Idee des Bildrasters basiert. Sein programmatisches
Bild in diesem Sinn war "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel la grande
Jatte" von 1886. Allerdings stößt er da mit seiner disziplinierten
Punkttechnik bei seinen Zeitgenossen nur auf wenig Resonanz, weil bereits
die Weichen hin zum Expressionismus gestellt sind, der den Pinselstrich
als Ausdrucksmittel braucht, und sich nicht mit einer fast maschinellen
Malweise begnügen will. Das Verfahren der Punktierung wandert in die
Lithografie ab als manuelle mehrfarbige Reproduktionstechnik. Lithografien
um die Jahrhundertwende arbeiten vielfach mit diesem zeitaufwendigen Verfahren.
Sie basieren auf einem manuellen und visuellen Farbseperationsverfahren.
Für jeden Farbauszug - und es waren meist mehr als drei Farben notwendig
- wurde ein eigener Druckstock hergestellt.
Etwa
zeitgleich mit Meisenbach entwickelt Seurat eine neoimpressionistische
Malerei, die auf der Idee des Bildrasters basiert. Sein programmatisches
Bild in diesem Sinn war "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel la grande
Jatte" von 1886. Allerdings stößt er da mit seiner disziplinierten
Punkttechnik bei seinen Zeitgenossen nur auf wenig Resonanz, weil bereits
die Weichen hin zum Expressionismus gestellt sind, der den Pinselstrich
als Ausdrucksmittel braucht, und sich nicht mit einer fast maschinellen
Malweise begnügen will. Das Verfahren der Punktierung wandert in die
Lithografie ab als manuelle mehrfarbige Reproduktionstechnik. Lithografien
um die Jahrhundertwende arbeiten vielfach mit diesem zeitaufwendigen Verfahren.
Sie basieren auf einem manuellen und visuellen Farbseperationsverfahren.
Für jeden Farbauszug - und es waren meist mehr als drei Farben notwendig
- wurde ein eigener Druckstock hergestellt.
 Wie
mir scheint, hat sich erst die Popart wieder für das Raster und den
Punkt interessieren können, und zwar in der Gestalt von Roy Lichtenstein,
bei dem es wieder auftaucht als malerische Reproduktion und ästhetisches
Zitat einer Reproduktionstechnik.
Wie
mir scheint, hat sich erst die Popart wieder für das Raster und den
Punkt interessieren können, und zwar in der Gestalt von Roy Lichtenstein,
bei dem es wieder auftaucht als malerische Reproduktion und ästhetisches
Zitat einer Reproduktionstechnik.