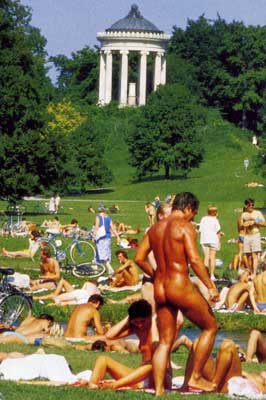"Ein Künstler muß sich in seiner Zeit bewegen und malen, was er sieht!"(Manet). Dieser Satz Manets kommt einem bekannt vor. Solches kennt man schon von Courbet. Der Tendenz nach klingt hier ein Programm des Realismus an. Was sieht Manet?
Auf einer Lichtung im Wald sitzen zwei bürgerlich gekleidete Herren mittleren Alters in Begleitung zweier Damen. Im Gegensatz zu den bekleideten Männern hat eine der Frauen, die im Vordergrund bei den Männern sitzt, ihre Kleidung völlig abgelegt, während die andere im Hintergrund immerhin noch im Unterkleid Erfrischung durch ein Fußbad in einem Gewässer sucht. Neben der Badenden liegt am Ufer das Gewässers ein Ruderboot, mit dem die Gruppe offenbar an diesen Ort, eine 'Insel der Seligen'? gekommen ist. Diagonal gegenüber in der linken unteren Ecke sehen wir auf den abgelegten Kleidern und dem Strohhut der Frau einen geflochtenen Korb, aus dem heraus Bestandteile einer Brotzeit, Früchte, Brot und eine Flasche oder metallisch glänzende Dose auf den Waldboden gepurzelt sind. Mit einem Wort läßt sich die Situation beschreiben als ein Picknick, also feiertägliche, bürgerlich-städtische Freizeitbeschäftigung. Ein neues Bildmotiv? Das Bild hieß ursprünglich "Le bain" und wurde schon bald umgetitelt in "Le déjeneur sur l'herbe". Ist es für das Thema unerheblich, ob wir an ein Bad oder an ein Picknick denken?


 Im
etruskischen Museum von Rom, der Villa Giulia, wird ein Sarkophag aus dem
6. Jh v.Chr aufbewahrt. Der Deckel ist plastisch ausgeformt und stellt
ein halb sitzendes, halb liegendes Paar dar. Ein heiterer, vergeistigter
Ausdruck liegt auf den Gesichtern, während die Hände in eindeutigen
Gesten auf eine Mahlzeit hinweisen, die man gerade zu sich nimmt. Ein Picknick?
So stellten sich die Etrusker vor zweieinhalbtausend Jahren das Jenseits
vor, ein niemals endendes Gelage, Seite an Seite mit einer geliebten Person.
Für mein Empfinden hat Manet diese aufs Jenseits gerichtete Vorstellung
in ein zeitgenössisches Gewand verpackt. Damit hat er die 'zeitlos'
gewordene Idee entweiht, wenn man so will. Aber er hat sie auch bewahrt.
Entweiht hat er sie, weil er sie in greifbare, alltägliche und triviale,
bürgerliche Nähe gerückt hat. Gerettet hat er sie, weil
er sie uns als vertraute und bewährte Vorstellung, als Bild auch erneuert.
Im
etruskischen Museum von Rom, der Villa Giulia, wird ein Sarkophag aus dem
6. Jh v.Chr aufbewahrt. Der Deckel ist plastisch ausgeformt und stellt
ein halb sitzendes, halb liegendes Paar dar. Ein heiterer, vergeistigter
Ausdruck liegt auf den Gesichtern, während die Hände in eindeutigen
Gesten auf eine Mahlzeit hinweisen, die man gerade zu sich nimmt. Ein Picknick?
So stellten sich die Etrusker vor zweieinhalbtausend Jahren das Jenseits
vor, ein niemals endendes Gelage, Seite an Seite mit einer geliebten Person.
Für mein Empfinden hat Manet diese aufs Jenseits gerichtete Vorstellung
in ein zeitgenössisches Gewand verpackt. Damit hat er die 'zeitlos'
gewordene Idee entweiht, wenn man so will. Aber er hat sie auch bewahrt.
Entweiht hat er sie, weil er sie in greifbare, alltägliche und triviale,
bürgerliche Nähe gerückt hat. Gerettet hat er sie, weil
er sie uns als vertraute und bewährte Vorstellung, als Bild auch erneuert.